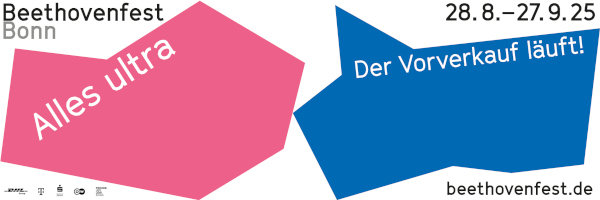Es ist acht Uhr morgens, die Regale sind voll. Brötchen, Laugenbrezeln, helle Brote und dunkle. Die Tür öffnet sich, ein Mann kommt herein, studiert das Angebot. "Ein Mühlenkrusti, bitte, und einen Kaffee zum Mitnehmen." – "Vergessen Sie Ihr Wechselgeld nicht", sagt die Verkäuferin, ehe der Kunde geht, der gerade die beliebteste Brotsorte Deutschlands gekauft hat: ein Roggenmischbrot.
Jedes dritte Brot, das hierzulande verkauft wird, ist ein Mischbrot wie das Mühlenkrusti. An zweiter Stelle kommt das Toastbrot. Im vergangenen Jahr kauften die Menschen in Deutschland rund 1,91 Millionen Tonnen Brot. Wer versucht, die Geschichte zu erzählen, die hinter einem solchen Brot liegt, das eben im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen für 2,95 Euro das Kilo über die Theke gegangen ist, lernt Menschen kennen, für die sich gerade viel verändert. Den Handwerksbäcker, der es mit Backindustrie und Teiglingen aus dem Ausland zu tun bekommt. Den Müller, der sich fragt, ob er es verantworten kann, dass sein Sohn auch diesen Beruf erlernt. Den Landwirt, der sich auf Saatgutherstellung spezialisiert hat und Spekulationen auf Nahrungsmittel nicht verteufeln mag.
Der Bäcker
Um ein Uhr nachts ist kaum Verkehr auf der Offenbacher Landstraße im Süden Frankfurts. Im Haus mit der Nummer 126 surrt ein Lüfter. Hinter einem großen Fenster im Erdgeschoss huscht ein Mann hin und her. Der Arbeitstag von Richard Kling, Inhaber der Bäckerei und Konditorei Kling und Obermeister der Bäckerinnung Frankfurt, hat gerade begonnen. Er trinkt die erste von zehn Tassen Kaffee in dieser Nacht und blickt auf eine Tabelle, "Rezept Wirtebrot Muehlbergkruste" steht darüber. Richard Kling, weißes T-Shirt, rote Schürze, graue Bäckerhose, befüllt die Knetmaschine. Er braucht 80 Kilo Teig, dafür kommen über 30 Liter Wasser, rund 700 Gramm Hefe, ein Kilo Salz, über drei Kilo "Sauer", 14 Kilo Weizen- und gut 30 Kilo Roggenmehl in den Bottich. Acht Minuten lang wird alles zusammengeknetet.
Der Bäcker liebt diese erste Stunde, "da hab ich meine Ruh", sagt er. "Bald geht hier die Thermik los." Damit meint er die Wärme in der Backstube. Und seine Leute, die ab zwei Uhr anfangen. Alle haben im Betrieb gelernt und sind schon lange dabei, einer seit 40 Jahren. In Frankfurt, einer Stadt mit knapp 700 000 Einwohnern, haben in diesem Sommer nur vier Gesellen bei ihm, dem Innungsmeister, ihre Prüfung abgelegt. Wer will schon nachts arbeiten und am Wochenende? Was aus seinem Handwerk wird, fragt er sich oft, wenn er allein in der Backstube steht. 55 Jahre ist er alt, er betreibt die Bäckerei in dritter Generation, sein Großvater hatte sie 1934 gegründet.
In großen Klumpen wuchtet der Bäcker den Teig auf die Arbeitsplatte, auf der eine Waage mit Gewichten steht. Sie ist von 1880, der Großvater hat sie gebraucht gekauft. Mit einer Teigscharre trennt er Teig ab und gibt ihn auf die Waage. Aus den Klumpen werden die Brote, ein bis sechs Pfund schwer. Das Gewicht hat Kling im Gefühl, nur selten muss er sich korrigieren. "Die wenigsten machen das heute noch so, diese Handarbeit." Kling sagt, dass er keinen Kompromiss eingeht, den er nicht eingehen möchte. Er meint damit Fertigmischungen. Oder Teiglinge, die gefroren angeliefert und aufgebacken werden. "Ich will mich in dem Zeug, das ich mache, auch sehen."
Andrea Diefenbach
Die Handwerksrolle verzeichnet in Deutschland gut 13 000 Bäckereibetriebe. 2006 waren es 16 000 und vor 60 Jahren 50 000 allein in Westdeutschland. 1975, als Richard Kling seine Ausbildung begann, zählten 300 backende Betriebe zur Frankfurter Bäckerinnung. Heute sind es noch 20. Dabei gibt es doch zumindest in der Großstadt an jeder Ecke einen Bäcker? Das täuscht, das sind bloß die Aufbackstationen der Großbäckereien.
Andrea Diefenbach
Deren Brote machen auch satt, sagt Kling. Nur für ihn wäre das nichts. Zum ersten Mal seit Jahren hat wieder ein Lehrling bei ihm angefangen. Er war im Sommer zu ihm gekommen, zum Reinschnuppern. Zuvor hatte er ein Praktikum in einer Großbäckerei abgebrochen, weil er da immer nur Brötchenteig auf Bleche gelegt hat. Zu eintönig. Bei Kling muss jeder alles können, alles lernen. Auf Noten aber gibt der Bäcker nichts. Er war früher schlecht in Englisch, trotzdem ging er 1991 in die USA und baute zwei Betriebe auf, die er verpachtet hat. Statt aufs Zeugnis schaut er Menschen in die Augen, sieht ihnen bei der Arbeit zu.
Der Bäcker beginnt zu kneten. Immer zwei Brote auf einmal, pro Hand eines. Um kurz vor zwei Uhr klingelt das Telefon, ein Koch ist am Apparat, er hat vergessen, für den kommenden Tag Brot für sein Lokal zu bestellen. "Ein Großbäcker könnte nun nicht mehr reagieren", sagt Richard Kling. Er beliefert traditionsreiche Apfelweingaststätten. Jede will ein anderes Brot, breite Laibe zum Beispiel, aus denen sich dicke Scheiben schneiden lassen. Sie kommen, wie alle anderen auch, in Gärkörbe. "Der Teig brauch nun a Ruh", sagt der Bäcker. Die Gärkörbe sind wichtig, ohne sie würden die Brote ganz flach. In der Industrie, sagt Bäcker Kling, werde der Teig deshalb auch härter gemacht.
Discounter sind Kulturkiller. Es wird keine kleinen Bäcker mehr geben
Mit großen Filialbäckern macht er seinen Frieden, aber die Industrie? Da traut er der Qualität nicht. Die Bedenken teilt Bäcker Kling mit vielen Menschen, immer wieder ist von importierter Backware zu lesen, die aus China nach Deutschland geliefert werde: Brot als Einfuhrware? Stimmt das? Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks klärt auf: Dass es in Deutschland importierte Teiglinge aus China gebe, sei ein Gerücht, das über das Internet gestreut werde. Aber: Um Deutschland herum seien, besonders in Osteuropa, einige Teiglingsfabriken entstanden.
Nur noch 44 Prozent aller Brote, die bei uns auf den Tisch kommen, stammen aus klassischen Handwerksbäckereien. Mehr als die Hälfte wird in Supermärkten und Discountern verkauft. Kling, ein freundlicher Mensch, klingt nun ernst wie ein Interessenvertreter. "Aldi und Lidl sind Kulturkiller. Es wird in Zukunft keine kleinen Bäcker mehr geben." Ein Roggenmischbrot kostet bei Aldi Süd etwa ein Drittel so viel wie Klings Mühlenkrusti und kommt auf Knopfdruck aus einem Automaten. Lieferant des Aldi-Brotes ist die Bäckerei Lieken, eine Unternehmensgruppe mit 700 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die produziert aber alle ihre Brote in Deutschland, sagt eine Sprecherin.
Am meisten ärgert sich Kling über die Energiekosten und die Umlage für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, beides belaste ihn im Monat mit 5000 Euro. Die Teigfabriken im Ausland müssten die Umlage nicht bezahlen. Heute noch mal eine Bäckerei gründen, wie sein Großvater vor 80 Jahren? "Unmöglich! Allein die Grundausstattung kostet 300 000 Euro. Das trägt keine Bank mit." Richard Kling hat sich die Bilanzen aus dem Jahr 1978 angesehen. "Um die Rendite von damals zu erzielen, müsste ein Brötchen bei mir nicht 35 Cent, sondern einen Euro kosten." Es ist nicht nur das Geld. Das Brot im Supermarkt oder beim Filialbäcker, der den ganzen Tag über im Ofen aufbacken kann, sieht immer gleich aus, wie geklont, und ist oft noch warm. "Das geht bei mir aber ned", sagt der Bäcker, "wenn’s ausverkauft ist, gibt es erst nachts wieder neues Brot." Die Kunden haben sich aber daran gewöhnt, dass der Laib immer gleich aussieht und schmeckt. Deshalb führt Kling keinen eigenen Sauerteig. Denn der braucht, sagt der Bäcker, absolut konstantes Klima, das kann er nicht bieten. Also greift er zum "Sauer", wie es auf seiner Brotback-Tabelle heißt: einem Dreistufen-Roggen-Sauerteig aus der Tüte. In dem stecke, versichert der Backzutatenverband, aber auch nur Roggen und Wasser; der daraus gewonnene Sauerteig wird getrocknet. – Aber Herr Kling, muss ein Bäcker nicht einen eigenen Sauerteig ziehen? "Ich kenne keinen, der das noch macht."
Der Kunde, der vier Stunden später einen der Laibe kauft, bekommt ein leckeres Brot. Außen ist es knusprig, es schmeckt frisch und passt gut zu Käse oder Schinken, fand die chrismon-Redaktion. Die Arbeit, die in so einem Laib steckt, sehen die Käufer nicht. Und auch nicht den Weg, den die Rohstoffe hinter sich haben. Die sind gar nicht weit, die Mühlen in Deutschland vermahlen zu über 90 Prozent Getreide, das hierzulande wächst – und sie beliefern zumeist Bäcker aus ihrer Region.
Der Müller
Der Fernseher hat die Bilder von den Soldaten, die in der Ukraine Getreidefelder durchkämmen, auch in das Wohnhaus der Philippis nach Schöneck-Büdesheim gebracht. Es liegt direkt an der Nidder, einem Flüsschen in der Wetterau, 20 Kilometer nordöstlich von Frankfurt. Die Not der Menschen hat Volker Philippi nicht kalt gelassen, klar. Aber er hat sich auch gefragt, wie sich der Krieg wohl auf die Getreidepreise auswirkt, wenn die Schießerei zu Ernteausfällen führt. Volker Philippi ist Geschäftsführer der Philippi-Mühle. Die Bäcker und Bauern, mit denen er zu tun hat, leben in einem Radius von 50 Kilometern um ihn herum – aber was draußen in der Welt passiert, kommt irgendwann auch in Schöneck an.
1845 hat ein Vorfahre die Mühle gekauft, sie ist in sechster Generation in Familienhand. Nun geht der Junior in Stuttgart zur Berufsschule und lernt Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft. Volker Philippi, 52 Jahre alt, ein Mann mit dunklen, leicht gelockten Haaren, findet, dass die Bezeichnung zu hochtrabend ist. "Ich sag immer, dass ich Müller bin."
Gerade fährt ein Traktor mit Anhänger zur Annahmegosse, der Müller nimmt eine erste Probe. Wie feucht ist das Getreide? Wie hoch ist der Stärkegehalt? Gibt es Käferbefall? Wenn die Ladung in Ordnung ist, kommt sie auf die Waage und verschwindet in einem langen Gitterrost, dem Sumpf. Druckluft und Siebe trennen Spreu und das Bruchkorn ab, das Korn lagert Volker Philippi in Silos ein, je nach Qualität. Für den Mahlvorgang mischt er sich zusammen, was er braucht. Sehr gutes Getreide kommt zu weniger gutem. So kann er das ganze Jahr über ein gleichbleibend gutes Mehl anbieten.
Andrea Diefenbach
Sieben Etagen hoch ist die Mühle, Röhren durchziehen die Stockwerke, in jedem stehen laute Maschinen. Sie reinigen das Getreide, trocknen es; Walzen quetschen die Körner, Siebe filtern das Mehl von der Schale. Abfall gibt es kaum, fast alles wird verwertet, zu Kleie, zu Gries. Die Walzen mahlen, bis die erwünschte Mehltype erreicht ist. Je höher der Typ, desto dunkler und körniger das Mehl. Vollkornmehl steht am Ende dieser Skala, in ihm ist das ganze Korn enthalten. Volker Philippi kann den Mahlvorgang von einem Raum aus kontrollieren, der an die Schaltzentrale eines Kraftwerks erinnert. Rote Lampen leuchten. Wenn es irgendwo klemmt, ertönt ein Sirenengeräusch.
Die Landwirte schielen auf die Preise, die an der Börse gehandelt werden
Bei den Getreidebauern beobachtet Philippi, wie die Betriebe immer größer werden. Früher kam ein Bauer mit acht Tonnen Getreide. Heute lagern viele ihr Getreide selbst ein und kommen damit erst zu ihm, wenn der Preis hoch ist. Dann fahren auch mal Lkw mit 26 Tonnen vor. "Die Landwirte sehen sich zunehmend als Großhändler und schielen immer auf die Preise, die an der Börse in Paris gehandelt werden." Und wer kauft sein Mehl? Es gibt weniger kleine Handwerksbäcker, dafür mehr Großbäckereien als früher. Und es gibt ganz neue Abnehmer. Auch ihretwegen verarbeitet Volker Philippi heute zu 90 Prozent Weizen und zu zehn Prozent Roggen. Früher war das Verhältnis ausgeglichen. "Das liegt daran, dass heute mehr Südländer in Deutschland leben, die verbacken nur Weizen." Er freut sich, wenn die türkischen Bäcker ihm bei Lieferfahrten etwas mitgeben, Pizza oder Fladenbrot. "Das ist mein Urlaub", sagt er, "ich verreise eigentlich nie."
Philippi konzentriert sich auf kleinere Bäcker. Gerade füllt einer seiner Mitarbeiter Roggenmehl Type 815 ab, ein recht helles Mehl ohne Schalenteile also. Es gibt einen Bäcker, der das haben möchte. Einen! Den Bäckern rät er: "Macht nur ein Brot, aber macht es supergut." Er hatte so einen Bäcker unter seinen Kunden. Der Nachfolger aber hat das Angebot ausdifferenziert – er braucht heute weniger Mehl als sein Vorgänger. Offenbar war die alte Strategie besser, vermutet der Müller. Sein Rat an den Brotkäufer: "Zum Handwerksbäcker gehen und nicht immer nach einer anderen Sorte fragen."
Andrea Diefenbach
Unser täglich Brot. Bedeutet es ihm etwas, dafür zu arbeiten? Auch, sagt Philippi. Aber noch wichtiger ist ihm, dass er alle zehn Jahre eine Investition gewagt hat, damit sein Sohn später weitermachen kann. Früher war immer freitags Großputz in der alten Mühle, den Holzboden fegen, wo der Staub in den Ritzen hing. Das ist in der neuen Mühle einfacher. Der Müller muss auch abends nicht mehr im Bett liegen und auf die Geräusche achten, ob alles richtig läuft. In die neue Technik hat er Vertrauen. Er hat trotzdem lange gegrübelt, ob er es verantworten kann, seinen Sohn in die Rolle des Nachfolgers wachsen zu lassen. Viele kleinere Bäcker geben ja auf. Das Risiko hat Philippi eingepreist.Für loses Mehl, das er im Silowagen zum Bäcker fährt, verlangt er pro 25 Kilo einige Euro weniger als für Sackware. – Herr Philippi, warum kostet das nicht immer gleich viel? "Das liegt an der Menge, die ein Bäcker abnimmt. Und daran, wie viel Arbeit wir vor Ort haben, ob wir zum Beispiel noch mit der Sackkarre arbeiten müssen. Es hängt aber auch an der Zahlungsmoral der Kunden. Außenstände werden ein Problem."
Gleich wird er mit dem neuen Silowagen losfahren, Mehl ausliefern. Für diese Fahrt steht der Preis. Aber was wird in Zukunft sein? In Südfrankreich war die Ernte schlecht, zu wenig Protein im Korn. "Klingt mir so, als hätten die es im Frühjahr zu trocken gehabt, dann wird der Dünger nicht aufgenommen." In der Wetterau war die Ernte gut. Es kann sein, dass die Franzosen Getreide oder Mehl zukaufen werden. Das könnte die Preise an der Börse treiben, die er den Bauern bezahlen muss. Von den Bäckern kann er aber nicht sofort mehr verlangen. "Es muss ja ein Leben und Leben lassen sein", sagt der Müller.
Der Landwirt
Steigende Preise? Die würden Matthias Mehl freuen, er ist Landwirt und Saatguthersteller. Sein Hof liegt im Frankfurter Norden, Stadtteil Nieder-Erlenbach. Von den Feldern hinter seinem Hof blickt man auf die Bankentürme, wo Menschen an Computern die Preise für seinen Weizen beeinflussen. Vor allem tun das natürlich die Getreidebörsen in Paris, Zürich, Chicago, aber das ist weit weg.
Andrea Diefenbach
Heute muss Matthias Mehl das Korn von den Halmen bekommen. Er nimmt eine Handvoll Weizenkörner und lässt sie in ein kleines Gerät fallen. Es mahlt und misst die Feuchtigkeit der Körner. 13,9 Prozent, genau richtig, um gedroschen zu werden. Wäre es zu feucht, müsste er das Getreide noch stehen lassen. Es ist der 23. Juli, 29 Grad Celsius, ein heißer, sonniger Tag, Erntezeit. Matthias Mehl bewirtschaftet etwa 190 Hektar. Ein Hektar, das ist ungefähr ein Fußballfeld. Damit ist sein Hof "ein ganz normaler Familienbetrieb". Dieser Tage arbeitet der Bauer von früh um sieben bis nachts zwei, drei Uhr. Seit elf Uhr am Vormittag läuft die Erntemaschine, da war der Tau abgetrocknet. Mehl fährt nun den Traktor mit Anhänger über Landstraße und Feldwege ins benachbarte Bad Vilbel, zum Feld "Am stolzen Kreuz". Blassgelb liegt das Getreide vor ihm, Winterweizen Asano A, die meistangebaute Sorte Deutschlands, hervorragender Ertrag. In der Mitte des Feldes zieht der Mähdrescher seine Reihen, hinter sich eine große Staubwolke, Strohhalme wirbeln umher. Der Speicher des Mähdreschers ist voll, der Fahrer fährt neben den Anhänger und lässt das Korn über ein Rohr hineinrauschen; 16 Tonnen passen hinein.
Dr. Matthias Mehl, 46, promovierter Agraringenieur, Landwirt in sechster Generation, produziert Sommer- und Wintergerste, Winterweizen, Grannenweizen, Wechselweizen. Er kauft Basissaatgut, vermehrt es, lässt es zertifizieren und verkauft es weiter – an die Raiffeisen Zentrale Rhein Main oder direkt an Landwirte. Und die bauen dann das Getreide an, das zu Mehl wird. Etwa drei Viertel seiner Ernte wird zu Saatgut, der Rest geht an die Mühle. 1872 pachteten Matthias Mehls Vorfahren den Hof, damals hatten Bauern von allem ein bisschen, Hühner, Vieh, Felder, so wie heute in Kinderbüchern. Matthias Mehls Großvater begann nach dem Krieg mit der Saatgutvermehrung, seit 1970 gibt es auf dem Mehl’schen Hof nur noch Hund und Katze. Nieder-Erlenbach gehört landschaftlich zur Wetterau, fruchtbare Lössböden, einst Kornkammer der Römer. Immer wieder haben Planer der Stadt Frankfurt die Idee, sie könnten hier einen neuen Stadtteil errichten. Matthias Mehl ist Frankfurter Kreislandwirt und CDU-Ortsvorsteher von Nieder-Erlenbach. Als solcher schrieb er an einem Antrag mit, man möge doch erst einmal die innerstädtischen Räume erschließen, statt hier Flächen zu versiegeln. Einstweilen ist die Idee vom Tisch.
Was er beeinflussen kann, das tut er, auch auf dem Feld. Matthias Mehl ist konventioneller Landwirt. Oder, wie er selbst sagt, er produziert "integriert": Dünger und Pflanzenschutzmittel so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Dr. Mehls zweites Standbein sind Zuckerrüben, außerdem produzieren die Solarpanels auf den Scheunendächern Strom, den er ins öffentliche Netz speist, 300 000 Kilowatt im Jahr. Er beschäftigt einen Mitarbeiter und einen Azubi, Mehls Vater hilft mit und auch Frau Mehl. Es braucht immer weniger menschliche Arbeitskraft in der Landwirtschaft, alles technisiert, wie überall.
"Zu sagen, Spekulanten treiben die Preise hoch, und die Armen in Afrika verhungern deswegen, das ist mir zu einfach"
Den Mähdrescher, ein John Deere, 250 000 Euro teuer, hat Mehl erst seit kurzem. Mit Monitor, Kameras, Satellitensignal. Mehl muss sich noch an die neuen Abläufe gewöhnen, innerhalb einer Stunde drischt die Maschine 30 Tonnen Weizen, zehn mehr als der alte. Seniorchef Karl-Hans Mehl, 73, erinnert sich, dass er als Kind noch mit dem Pferd gefahren ist. Im Drescher sitzt heute ein Bekannter von Matthias Mehl, ein Betriebswirt, der sich immer sommers Urlaub nimmt, um seinen Kindheitstraum zu leben – Mähdrescher fahren. Stoisch lenkt er die Maschine über die Felder, trotz der Sommerhitze trägt er einen langen schwarzen Overall, in der Kabine sind nur 20 Grad. Vorne liegen eine gelbe Butterbrotdose und eine Thermoskanne mit Kaffee, der Tag wird lang. Zehn Hektar wollen sie heute noch schaffen. Um Mitternacht ist Feierabend, die Hälfte der Felder geerntet. Die Körnerhaufen in den Lagerhallen wachsen immer höher.
Drei Wochen später ist Matthias Mehl längst fertig mit der Weizenernte. Seine Frau hat schon ein Erntebrot 2014 gebacken, ein Weizenvollkornbrot nach einen Rezept ihrer Oma. "Sie backt nur auf meinen besonderen Wunsch", sagt Mehl, da stehe man einen halben Tag in der Küche für zwei, drei Brote. Mit seiner Ernte ist er zufrieden, 100 Tonnen passten nicht in sein Lager, die hat er gleich zur Mühle gefahren. Den Rest versucht er vorzuhalten, denn der Weizenpreis ist zur Erntezeit niedrig, etwa 150 Euro pro Tonne. Erntedruck nennt er das.
Vor Jahren wurden die Finanzmärkte liberalisiert, das ermöglichte exzessive Spekulationen mit Nahrungsmitteln. Seitdem schwankt der Preis stark. 2012 kostete eine Tonne Weizen 260 Euro. "Zu sagen, Spekulanten treiben die Preise hoch, und die Armen in Afrika verhungern deswegen, das ist mir zu einfach", sagt Mehl. Er selbst sei ja auch so etwas wie ein Spekulant, der sein Getreide einlagere, um später einen möglichst hohen Preis zu erzielen. "Ich verteufle das nicht", sagt er, "hohe Preise ziehen ja auch Produktionssteigerungen nach sich, ich kaufe dann zum Beispiel bessere Maschinen und kann die Erträge steigern."
Hier wird es vielleicht besser – aber, Herr Mehl, die Ärmsten in Afrika können sich dann kein Brot leisten! "Man kann den Hunger der Welt nicht von hier aus lösen", sagt er. Da müssten stabilere politische Verhältnisse her, die freies Wirtschaften ermöglichten. "Jetzt ist der Getreidepreis niedriger als vor zwei Jahren, aber keiner sagt, dass die Leute weniger hungern." Bis weit in den September brummt die Saatgutreinigungsmaschine auf dem Hof, in der Lagerhalle stehen mannshohe weiße Säcke, darin sein bestes Korn. Gerade jetzt keimt es irgendwo in einer Ackerfurche. So geht es immer weiter.