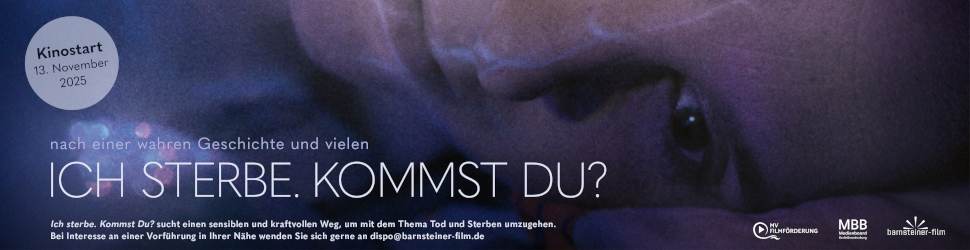- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Knapp zehn Jahre ist es her, dass Sie den Entschluss gefasst haben, am Ende Ihres Lebens keine Umweltschulden zu hinterlassen. Wie kommt man auf so eine Idee?
Dirk Gratzel: Ich komme aus dem Arbeitermilieu und hatte als Ehemann und Vater die Vorstellung, dass es meiner Familie materiell möglichst gut gehen müsse. Oder, in saloppem Ruhrgebietsdeutsch: "Der Junge soll et mal besser haben als wir!" – das war ein ganz starkes und prägendes Motiv. Wir haben fünf Kinder, drei Jungs, zwei Mädchen. In vielen Gesprächen mit meinen Kindern – besonders auch, als sie in der Pubertät waren – habe ich festgestellt, dass das Materielle für sie bei weitem nicht die Rolle spielte, die ich vermutet hatte. Mit 18 den Führerschein machen? Irrelevant! Meine Kinder haben sich teilweise vegetarisch und vegan ernährt, Secondhand eingekauft und zogen später in WGs statt in eigene Wohnungen. Das hat mich nachdenklich gemacht.
Viel Reichtum wird vererbt, Sie haben sich hochgearbeitet. Wie haben Sie das geschafft?
Ich stamme aus einer Bergarbeiterfamilie im Essener Norden, mein Opa und meine Onkel mütterlicherseits waren alle unter Tage. Mein Vater ist gelernter Maurer und Schlosser. Ich habe als Erster in meiner Familie Abitur gemacht und Jura studiert, dazu noch Wirtschaft. Ich habe eine Anwaltszulassung und arbeitete zunächst in der Automobilwirtschaft, bevor ich mich selbstständig machte.
2016 änderten Sie Ihr Leben, das war kurz vor Greta Thunberg und Fridays for Future.

4 Wochen gratis testen, danach mit 10 € guten Journalismus und gute Projekte unterstützen.
Vierwöchentlich kündbar.