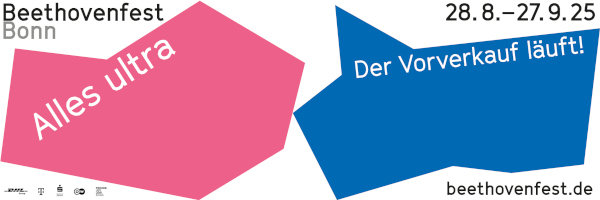Jesus heilt ein junges Mädchen. Das ist nichts Besonderes, zumindest für die Bibel. Darin wird erzählt, er habe Blinde, Lahme und Aussätzige geheilt und einmal soll er sogar ein Mädchen aus dem Tod geholt haben. Unsere Geschichte von der kanaanäischen Frau (Matthäus 15, 21-28) trägt deshalb außergewöhnliche Züge, weil Jesus sich zunächst weigert, die Tochter der Frau zu heilen. Er mag nicht. Er hat keine Lust und besteht auf dem Argument, er müsse seine Kraft einteilen und seine göttlichen Reserven für das Volk Israel und dessen Heilung einsetzen.
Ein kühler Messias, der einer Hilfe suchenden Frau die kalte Schulter zeigt, weil sie keine Jüdin ist, sondern Ausländerin. Für Gott und seinen Heilsplan, meint Jesus, sind die Israeliten die Bundesgenossen, die Zukunft der Welt, die Kinder Gottes, während den kanaanäischen Nachbarn der Status des räudigen Hündchens zukommt. Gegen diesen Rückzug auf angeblich göttliche Strategien mit der Welt schreit eine Frau an: Sie schreit um Erbarmen. Sie lässt nicht von ihm ab. Sie tritt ihm in den Weg. Sie fällt ihm buchstäblich vor die Füße: "Herr, hilf mir!" Und der göttliche Plan kommt ins Wanken angesichts der übermäßigen Verzweiflung einer Mutter angesichts der unmäßigen Hoffnung einer Frau.
Wir können uns das Leben dieser namenlosen Frau nur vorstellen. Sie ist eine Frau in einer männerdominierten Gesellschaft: Eigentlich ist es ihr nicht gestattet, von sich aus einen Mann anzusprechen. Sie ist eine Mutter, die sich für ihre Tochter einsetzt: Es geht "nur" um das Mädchen, noch nicht einmal um den Stammhalter. Von einer Familie oder einem Gatten ist nicht die Rede: Sie handelt auf eigene Faust und nach eigenem Plan. Und fürwahr, diese namenlose Frau hat ihren Platz in der Bibel verdient, denn sie bricht alles geltende Recht aus Liebe und Verzweiflung.
Ihr Mädchen scheint psychisch krank zu sein. Was genau sie hat, wissen wir nicht. Wir sehen nur den Spiegel ihrer Krankheit in der Verzweiflung der Mutter. Sie war bei Ärzten und bei Priestern. Sie war bei Wunderheilern und Gesundbetern. Sie hat alles versucht, mit Ernährungsumstellung und mit Beten. Und alles hat nicht geholfen. Das Kind verliert von Tag zu Tag mehr seine Seele. Was für eine Verzweiflung! Was für ein Schmerz! Jesus ist die letzte Hoffnung. In der Kraft ihrer Verzweiflung schreibt die Frau ohne Namen aus den kanaanäischen Dörfern Weltgeschichte. Sie erbittet die Heilung ihrer Tochter. Sie zwingt Jesus, den arroganten Heiland, in ein Gespräch. Als seine Jünger ihn bitten, die schreiende Frau doch zum Schweigen zu bringen, erklärt er sich für nicht zuständig. Er sei exklusiv für das erwählte Volk da, nicht für Ausländer. Aber sie lässt sich nicht wegschicken, sondern verwickelt den Messias in einen Disput: Für wen ist er zuständig? Wenn er doch für die Israeliten da ist, warum kann von seiner Heilkraft für die anderen Menschen dieser Welt nicht auch etwas abfallen? Heil kennt doch keine Grenzen? Heil macht nicht Halt vor Rassen- oder Volkszugehörigkeit? Heil und Heilung müssen doch ausstrahlen auf das ganze Haus der Welt?!
Die namenlose Frau, die die damaligen Grenzen von Respekt und Anstand mehrfach überschreitet, wird zum Meilenstein für Jesus. Er begreift, dass Gottes Liebe alle Menschen meint und Gottes Kraft auf alle Menschen übergehen möchte. Er spürt, dass Gottes Erwählung eines Volkes übergehen muss in die Erwählung der Menschheit. Denn die Sehnsucht nach Liebe und Frieden, nach Heilsein und Angenommensein ist grenzenlos und fordert deshalb einen Gott, der alle Grenzen vergisst. Aus der Verzweiflung einer Mutter und aus der Heilung eines Mädchens wird Gottes Liebesgeschichte mit der ganzen Welt. Eine weltbewegende Szene.