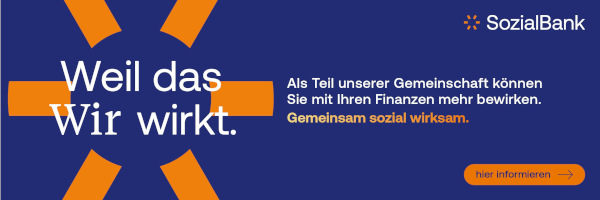Wer sich ärgert, weil Jesus sich wie ein erschöpfter Ehemann niederlässt und die Wasserholerin klassisch patriarchalisch auffordert, sie solle für sein leibliches Wohlbefinden sorgen, der sollte das besser bleiben lassen. Die Brunnenszene ist ein geradezu revolutionäres Paradestück für die Aufwertung des weiblichen Teils der Menschheit und für einen Umgang miteinander, der auf kleinkarierten Nationalismus pfeift.
Ungehörigerweise es gehörte sich damals nicht, als Mann eine Frau anzusprechen richtet der Jude Jesus das Wort an eine Frau. Zu allem Überfluss ist sie eine Samaritanerin, ein Erbfeindin aus jenem Volk, das nur die ersten fünf Bücher Mose als heilige Schriften anerkennt und mit dem Heiligtum in Jerusalem nichts am Hut hat. Ein Volk, dessen Vorfahren stattdessen auf dem Berg Garizim Gott anbeteten und das einen Endzeitpropheten erwartet.
Auf der Durchreise von Jerusalem nach Galiläa, gewissermaßen en passant, erledigt Jesus von Nazareth an einem Brunnen in Samarien ein paar Vorurteile, die bestenfalls das Leben schwer machen, schlimmstenfalls zu Unterdrückung und Mord führen. "Gib mir zu trinken!": Diese schlichte Bitte macht aus zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts, verschiedener Nation und Religion einfach zwei Menschen, die sich unmittelbar begegnen.
Aber selbst die unterprivilegierte und missachtete Frau wittert nicht gleich den Duft der Freiheit. Auch sie hat das von Juden und Samaritanern gehegte Feindbild so verinnerlicht, dass sie Jesus sofort als Fremden bestimmt und ihn auf das zu erwartende Verhalten festlegt. Er signalisiert mit einer elementaren Geste Partnerschaft, sie weicht erschreckt zurück. Die Opferrolle beizubehalten kann, so pervers das sein mag, bequemer sein, als sich zu neuen Horizonten aufzuschwingen.
Im Umgang mit Jesus hat diese Opferhaltung aber keinen Bestand. Er und die Botschaft, für die er steht, sind grenzüberschreitend. Sie zwingen dazu, eigene Maßstäbe und Urteile zu überprüfen. Sie fordern dazu heraus zu unterscheiden, was Mann und Frau für ihr Dasein wirklich brauchen. Wer seinen Lebensdurst nicht ausschließlich mit Sekt und Selters stillt, spürt: Christlicher Glaube ist ein Lebenselixier, ein Jungbrunnen für den Verstand.